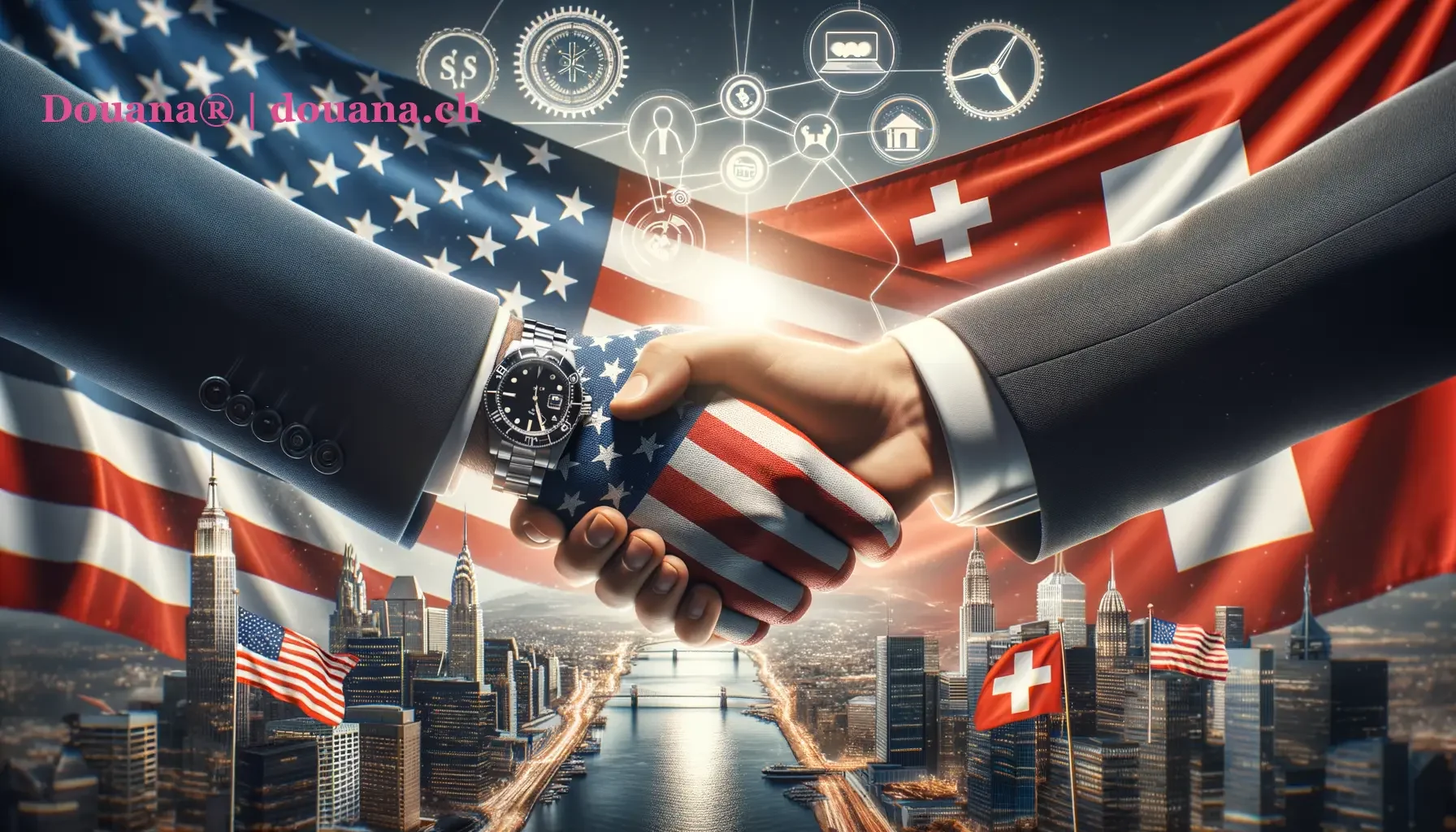Freihandelsabkommen Schweiz–USA: Chancen, Herausforderungen und Perspektiven
Historische Entwicklung der Handelsbeziehungen
Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten hat eine lange Tradition. Schon im 19. Jahrhundert begannen Schweizer Unternehmen, in den amerikanischen Markt zu investieren. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich der Handel stetig, wobei die USA heute einer der wichtigsten Exportmärkte für die Schweiz sind. Die beiderseitigen Direktinvestitionen sind beträchtlich und unterstreichen die Bedeutung einer engen bilateralen Kooperation:Besonders im Pharmabereich ist die Schweiz einer der bedeutendsten Exportpartner der Vereinigten Staaten. Bereits 2021 entfielen 26% aller Schweizer Pharmaexporte auf den US-Markt. Unternehmen wie Roche und Novartis generieren einen beträchtlichen Anteil ihrer Umsätze in den USA. Die Stabilität dieser Beziehungen ist von hoher Bedeutung.
Aktuelle Rahmenbedingungen und Verhandlungsverlauf
Hintergründe der Verhandlungen
Mit dem bisherigen Grundzollsatz von 10% und der Ausnahme von Pharmazeutika wurde die Schweiz bisher vor fatalen Risiken bewahrt - der Aufschub der reziproken Zölle (Aktuell 31% ist bis Anfangs August gesichert, was danach geschieht, ist noch nicht bekannt. Die Hoffung auf ein Abkommen ist auf seiten Schweiz daher gross - ob es zu einem umfassenden Deal kommt, steht noch in den Sternen. Während bisher von einem umfassenden Abkommen geträumt wurde, geht es aktuell eher um Schadensbegrenzung. Trotzdem:Chancen durch ein Abkommen Schweiz mit den USA
Eine Studie von Avenir Suisse bescheinigt einem umfassenden Abkommen enormes Potenzial: Binnen fünf Jahren könnte das Handelsvolumen um mehr als 14 Milliarden US-Dollar steigen und über 40.000 neue Arbeitsplätze entstehen – davon 27.500 in den USA und 13.500 in der Schweiz. Dass es zu einem solcgh umfassenden Abkommen kommt, ist unserer Meinung nach unrealistisch, wäre jedoch ein unerwarteter Paukenschlag. Im Fokus der Schweiz stehen:
- Wachstumsimpulse für Hightech-Industrien, Exportwirtschaft und innovative Sektoren wie Pharma
- Technologische Kooperation und Stärkung internationaler Lieferketten
Zentrale Konfliktfelder und Herausforderungen
Herausforderungen im Abkommen
Trotz Optimismus bleiben ungelöste Fragen: Schweizer Exporteure, insbesondere aus dem nicht-landwirtschaftlichen Sektor, leiden unter hohen Zöllen. 2017 zahlten Schweizer Unternehmen rund 300 Millionen Franken an US-Zölle. Im Gegenzug sind US-Exporte in die Schweiz bereits weitgehend zollfrei. Jedoch ist die Schweiz weltweit für eine sehr restriktive Agrarpolitik bekannt, daher sind diese auch ein zentraler Streitpunkte nebst regulatorische Divergenzen und der Schutz geistigen Eigentums. Ebenso steht Circumvention oft im Fokus der Verhandlungen der USA (siehe nachfolgende Erläuterungen zum Thema). Interessant ist die Tatsache, dass die Schweiz bereits einen Freihandelsabkommen mit China pflegt, dieses erweitert werden soll und die Gespräche in Genf paralell mit den beiden Parteien geführt hat.Industrien: Bedürfnisse im Fokus
- Uhrenbranche: Hoffnung auf spürbare Entlastung durch reduzierte US-Zölle [Hodinkee]
- Pharmaindustrie: Profitiert von abgebauten Handelshemmnissen und vereinfachten Zulassungsverfahren, Investitionen absichern
- US-Unternehmen: Gestärkter Marktzugang für Dienstleistungen und Hightech
- Neue Impulse für KMU und Start-ups
Regulatorische Harmonisierung und bestehende Standards am Beispiel MRA
Das 2023 geschlossene Mutual Recognition Agreement (MRA) über die gegenseitige Anerkennung von GMP-Standards reduzierte die administrative Belastung für Unternehmen erheblich. Es ermöglicht eine schnellere Zulassung, vermeidet doppelte Inspektionen und sorgt für reibungslose Lieferketten. Die Vereinbarung stärkt nicht nur den Handel, sondern schützt auch Arbeitsplätze und die öffentliche Gesundheit in beiden Ländern. Die Bedürfnisse gehen somit über die blosse Senkung von Zöllen hinaus:- Kostensenkung und Innovationsschub für Unternehmen
- Besonders relevant für Medizintechnik, Maschinenbau, erneuerbare Energien
- Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit beider Standorte
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen
Effekte am Arbeitsmarkt
Ein Abkommen birgt das Potenzial, Arbeitsmärkte in beiden Ländern nachhaltig zu beeinflussen. Neben direkten Beschäftigungseffekten ist auch mit erhöhter Mobilität von Fachkräften, Know-how-Transfer und Innovationsschüben zu rechnen. Gleichzeitig birgt die Marktöffnung Risiken für weniger wettbewerbsfähige Branchen, etwa durch stärkeren Preisdruck und steigende Konkurrenz. Langfristig könnten beide Wirtschaften agiler und widerstandsfähiger gegenüber internationalen Krisen werden.Politische Debatte und öffentliche Wahrnehmung
In beiden Ländern wird das angestrebte Abkommen kontrovers diskutiert. Schweizer Wirtschaftsverbände begrüssen die Öffnung, während landwirtschaftliche Interessen skeptisch sind. In den USA wird die Schweiz als verlässlicher Partner gesehen, zugleich aber auf Gleichbehandlung und faire Wettbewerbsbedingungen gepocht. Die öffentliche Akzeptanz wird massgeblich davon abhängen, inwieweit soziale und ökologische Standards gewahrt sowie Nachteile für spezifische Branchen wirksam abgefedert werden.
Perspektiven: Circumvention im Visier der Handelspolitik
Was sind Circumvention-Geschäfte?
Circumvention – auch Umgehungsgeschäfte genannt – beschreibt Strategien, mit denen Unternehmen versuchen, handelspolitische Beschränkungen wie Strafzölle, Exportverbote oder Ursprungsregeln zu umgehen. Typischerweise geschieht dies, indem Waren über sogenannte Transitländer oder Zwischenstationen geführt oder dort leicht weiterverarbeitet werden, um einen anderen Ursprung zu erreichen oder gar vorzutäuschen – und so von günstigeren Zollbedingungen zu profitieren.
Ein Beispiel: Stahl aus China wird zunächst in die Schweiz exportiert, hier minimal bearbeitet oder umverpackt – und anschliessend als schweizerisches Produkt in die USA eingeführt. So sollen etwaige Strafzölle auf chinesische Ursprungsware vermieden werden.
Warum rücken diese Geschäfte in den Fokus?
Insbesondere die USA beobachten unter der Trump-Administration solche Transitrouten zunehmend kritisch. In neuen Abkommen – etwa mit Vietnam oder auch mit der Schweiz – besteht wachsendes Interesse daran, “Rules of Origin Enforcement” zu verschärfen. Das bedeutet:
-
Herkunftsangaben werden strenger überprüft
-
Unternehmen müssen nachweisen können, woher Vormaterialien tatsächlich stammen
-
Auch kleinste Verarbeitungsschritte zählen nicht mehr automatisch als Ursprungserzeugung
Zollbehörden werten diese Circumvention-Konstrukte immer häufiger als Missbrauch – mit empfindlichen Konsequenzen: Nachverzollung und Bussgelder.
Empfehlung für Schweizer Unternehmen
Unternehmen, die in internationalen Lieferketten eingebunden sind müssen sich frühzeitig mit folgenden Fragen auseinandersetzen:
-
Woher stammen unsere Vormaterialien wirklich?
-
Welche Produktionsschritte wurden in der Schewiz durchgeführt – und reichen diese für eine Ursprungseigenschaft aus?
-
Sind unsere Stammdaten transparent und auditierbar?
-
Wie dokumentieren wir Herkunft und Verarbeitungsketten rechtssicher?
Setzen Sie auf proaktive Risikoprüfung. Unternehmen sollten jetzt Lieferketten analysieren, Herkunftsnachweise sichern und sich auf verschärfte Prüfstandards vorbereiten. Im Fokus stehen insbesondere Länder, die von höheren Zöllen als die Schweiz betroffen sind. Hier die aktuellste Liste (Stand 10. Juli 2025):
Gegenseitige Zolltarife für 22 Länder festgelegt
Ab dem 9. Juli 2025 hat die US-Regierung gegenseitige Zolltarife für 22 Länder festgesetzt. Diese Zölle sollen ab dem 1. August 2025 in Kraft treten, sofern keine neuen Handelsabkommen abgeschlossen werden (gültig ab 1. August):
- Japan – 25 % (↑ von 24 %)
- Südkorea – 25 % (wie im April)
- Malaysia – 25 % (↑ von 24 %)
- Kasachstan – 25 % (↓ von 27 %)
- Tunesien – 25 % (↓ von 28 %)
- Südafrika – 30 % (wie im April)
- Bosnien & Herzegowina – 30 % (↓ von 35 %)
- Indonesien – 32 % (wie im April)
- Serbien – 35 % (↓ von 37 %)
- Thailand – 36 % (wie im April)
- Myanmar – 40 % (↓ von 44 %)
- Libyen – 30 % (↓ von 31 %)
- Irak – 30 % (↓ von 39 %)
- Algerien – 30 % (wie im April)
- Moldawien – 25 % (↓ von 31 %)
- Brunei – 25 % (↑ von 24 %)
- Philippinen – 20 % (↑ von 17 %)
- Sri Lanka – 30 % (↓ von 44 %)
- Bangladesch – 35 % (↓ von 37 %)
- Kambodscha – 36 % (↓ von 49 %)
- Laos – 40 % (↓ von 48 %)
- Brasilien – 50 % (↑ von 10 %)
Vietnam – Nicht in der Executive Order enthalten. Trump schrieb am 2. Juli auf Truth Social, dass Vietnam möglicherweise mit einem Zoll von 20 % (und 40 % auf umgeleitete/transshipment-Waren) belegt wird, aber es wurde noch keine offizielle Mitteilung veröffentlicht.
Wichtige Hinweise zur Durchsetzung:
-
Umgeleitete Waren können mit dem höchsten verfügbaren Zollsatz belegt werden, einschließlich des 40 %-Satzes aus Trumps Vietnam-Post.
-
Vergeltungszölle dieser Länder werden von den USA gespiegelt und hinzugefügt.
-
China ist nicht in diese Erweiterung einbezogen und unterliegt weiterhin einem separaten Aussetzungsbefehl (EO 14298).
-
Zollnummern, die unter dem HTSUS ausgesetzt sind, umfassen 9903.01.43–.62, .64–.76, sowie ausgewählte Anmerkungen zu Kapitel 99.
-
Fertigung in den USA bleibt oft der einzige Weg, um Zölle unter dieser Regelung zu vermeiden.
Weitere Länder könnten in den kommenden Tagen und Wochen benachrichtigt werden. -
CBP bestätigte über CSMS #65573545, dass 10 % Zölle für alle Länder (ausser China) bis zum 1. August gemäß HTSUS 9903.01.25 in Kraft bleiben.
Der nächste Schritt ist die Finalisierung und Ratifizierung eines Vertragswerks zwischen der Schweiz und den USA. Entscheidend wird sein, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktöffnung und Schutz sensibler Sektoren gefunden wird. Bei erfolgreicher Umsetzung könnte das Abkommen als Blaupause für weitere bilaterale Deals dienen. Es bleibt abzuwarten, ob die Erwartungen an Wachstum, Beschäftigung und Innovationskraft tatsächlich erfüllt werden.